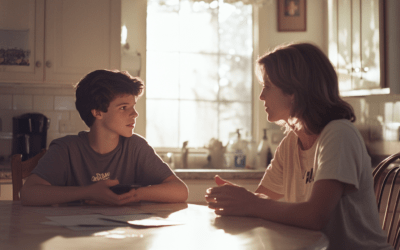Medienerziehung zuhause leicht gemacht
> Du bist Vater, Mutter oder kümmerst dich um ein Kind? Du weißt gar nicht, was dein Kind auf Social Media so macht oder fragst dich, ob dein Kind zu viel zockt?
Wir helfen dir mit Tipps, Materialien und Veranstaltungen.

Jetzt unsere Elternangebote buchen: Informieren, Verstehen, Begleiten
Unsere Shifties:
Welcher Medien-
nutzungstyp ist dein Kind?
Nicht alle Kinder nutzen Games und digitale Medien auf die gleiche Weise. Jedes Kind hat unterschiedliche Bedürfnisse, die durch digitale Medien erfüllt werden. Entdecke unsere Shifties! Sie zeigen dir, was hinter dem Verhalten von Kindern steckt, wie du dein Kind gut begleiten kannst und worauf du in der Medienerziehung achten solltest.





Finde passende Materialien
Test: Welcher Shiftie bist du?
Digitale Medien gehören für Kinder, Jugendliche und Erwachsene längst zum Alltag. Aber was bedeutet das eigentlich für jede*n von uns ganz persönlich? Der Shifties-Test lädt Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu ein, ihr eigenes Medienverhalten zu reflektieren: ehrlich, wertfrei und auf Augenhöhe.
Rollenspiel: Let‘s talk about… Mediennutzung
„Wann krieg’ ich endlich ein eigenes Smartphone? Ich bin der/die einzige ohne!“ – solche Sätze hören viele Eltern früher oder später von ihren Kindern. Auch „Roblox ist doch total harmlos! Kann ich das auch endlich bekommen?“ gehört in den Alltag vieler Familien. Hinter diesen Fragen steckt nicht nur der Wunsch nach digitalen Medien, sondern auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Selbstbestimmung und Vertrauen.
Gemeinsam spielen – digital trifft analog!
Digitale Spiele können nicht nur faszinieren, sondern auch Brücken bauen – hin zu echten, gemeinsamen Momenten in der Familie. Dieses Material zeigt dir, wie digitale Spielerlebnisse ganz einfach in die analoge Lebenswelt gebracht werden können. Du bekommst gezielte Empfehlungen, wie du die Begeisterung deines Kindes für digitale Spiele aufgreifen kannst.
Kids, Gaming & Social Media: Mehrsprachige Tipps & Beispielfragen
In digitalen Medien, wie Games und Social Media Plattformen, gibt es unterschiedliche Mechanismen, die dafür verwendet werden, um Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Weise unter Druck setzen. Unser Taschengeld-Planer hilft Kindern und Jugendlichen, einen Überblick über ihre Ausgaben in Games zu bekommen und diese Mechanismen zu hinterfragen.
Was sind eigentlich Dark Patterns? Mehrsprachige Broschüre zur Förderung einer gesunden Mediennutzung
In digitalen Medien, wie Games und Social Media Plattformen, gibt es unterschiedliche Mechanismen, die dafür verwendet werden, um Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Weise unter Druck setzen. Diese Broschüre gibt dir einen guten Überblick, was Dark Patterns genau sind.
Taschengeld-Planer – Gaming Edition
In digitalen Medien, wie Games und Social Media Plattformen, gibt es unterschiedliche Mechanismen, die dafür verwendet werden, um Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Weise unter Druck setzen. Unser Taschengeld-Planer hilft Kindern und Jugendlichen, einen Überblick über ihre Ausgaben in Games zu bekommen und diese Mechanismen zu hinterfragen.
Digitale Mediennutzung und Gesundheit
Was ist Medien- oder Gamingsucht? Gibt es einen Unterschied zu Abhängigkeit? Und ab wann musst du dir bei deinem Kind tatsächlich die Frage stellen, ob es einfach gerade gern und viel zockt, oder ob eine Sucht oder Abhängigkeit vorliegt?
Digitale Medien – aber sicher!
Bei dir zuhause gibt es sicher auch oft Fragen zur Nutzung technischer Geräte. Wir haben für dich hilfreiche Materialien zusammengestellt, die dir Entscheidungshilfen bei der Nutzung technischer Geräte liefern und dich dabei unterstützen können, Geräte und Apps sicher für dein Kind einzustellen.
Risiken und Gefahren von Gaming und Social Media Nutzung
Digitale Mediennutzung wie Gaming und Social Media gehört zum Alltag und Leben deines Kindes dazu! Damit du selbst besser einschätzen kannst, welche Games oder Apps harmlos sind und auf welche Weise sie angemessen genutzt werden können, gibt es hier ein paar Hintergrundinfos für dich.
Digitale Medien: Mehrsprachiges Nutzungstagebuch für die ganze Familie
Digitale Medien werden in deiner Familie immer wichtiger. Eventuell gibt es Unsicherheiten oder Streit wegen der Nutzung dieser Medien bei euch zu Hause? Reden kann helfen! Am Anfang von jedem guten Gespräch steht aus unserer Sicht ein gemeinsames Nachdenken.
Du fragst – GAMESHIFT NRW antwortet
Wie merkst du, ob dein Kind spielsüchtig ist?
Grundsätzlich gilt erst einmal: Wenn dein Kind viel Zeit mit Gaming und auf Social Media verbringt, kann das zwar aus deiner Sicht Zeitverschwendung sein. Es kann sein, dass dein Kind sogar schlechtere Noten schreibt oder andere Hobbies weniger wichtig geworden sind. Von einer „Sucht“ oder „Abhängigkeit“ ist allerdings erst in besonders starken Fällen auszugehen. Und auch dann ist das eine Krankheit und sollte von Fachleuten begutachtet werden! Es gibt aber einige Anzeichen, die du im Blick halten kannst, um besser einschätzen zu können, ob bei deinem Kind ein ungesundes Spielverhalten vorliegt:
- Zeit: Dein Kind verbringt übermäßig viel Zeit mit Videospielen, vernachlässigt dabei andere Aktivitäten wie Hausaufgaben, Freunde treffen oder Hobbys.
- Stimmungsschwankungen: Dein Kind reagiert gereizt, frustriert oder missmutig, wenn es nicht spielen kann oder unterbrochen wird. Es kann auch Anzeichen von Nervosität oder Unruhe zeigen.
- Gesundheitliche Auswirkungen: Dein Kind kann physische Probleme wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Augenbelastung oder Bewegungsmangel aufgrund des übermäßigen Spielens haben.
- Soziale Isolation: Dein Kind zieht sich von Freunden, Familie oder anderen sozialen Aktivitäten zurück, um mehr Zeit mit Videospielen zu verbringen.
- Leistungsabfall: Die schulischen Leistungen deines Kindes könnten sich verschlechtern, da es mehr Zeit mit Spielen verbringt und weniger Zeit für Lernen und Hausaufgaben hat.
- Fortsetzung des Spielens trotz negativer Konsequenzen: Dein Kind spielt weiter, auch wenn es negative Folgen wie Strafen, Konflikte mit Eltern oder schlechte körperliche Gesundheit erlebt.
Wenn du besorgt bist, dass dein Kind möglicherweise spielsüchtig ist, ist es wichtig, professionelle Hilfe in Betracht zu ziehen. Hier können z.B. Psycholog*innen, Therapeut*innen oder Suchtberater*innen helfen. Es ist ebenso wichtig, offene Gespräche mit deinem Kind zu führen, um über die Bedenken zu sprechen und gemeinsam mögliche Lösungen zu finden.
In diesem Beitrag haben wir für dich passende Stellen und Maßnahmen zusammengestellt, die dir helfen können. Außerdem findest du dort Quellen zum Thema ungesunde Mediennutzung.
Kann ich ein Game oder eine Social Media-Anwendung kindersicher machen?
Ja, du kannst ein Spiel oder eine Social Media App sicherer für dein Kind machen. Es gibt einige einfache Schritte, um den Zugang zu ungeeigneten Inhalten zu begrenzen und die Privatsphäre zu schützen. Hier sind einige Tipps:
Kindersicherungen und Jugendschutz nutzen
- Spielkonsolen (wie PlayStation oder Xbox) haben Jugendschutzeinstellungen, die ungeeignete Inhalte filtern und Käufe einschränken.
- Smartphones und Tablets haben Kindersicherungen, mit denen du den Zugriff auf Apps und In-App-Käufe kontrollieren kannst. Du kannst auch Zeitlimits festlegen.
In dieser interaktiven Schritt-für-Schritt-Anleitung von Medien Kindersicher lernst du, wie du entweder gezielt Geräte oder die Apps und Dienste so einstellst, dass die von deinem Kind sicher genutzt werden können.
Altersbeschränkungen beachten
- Überprüfe, ob das Spiel oder die Social Media-App eine Altersfreigabe hat, die für dein Kind geeignet ist.
- Achte auf Social Media-Plattformen wie Instagram oder TikTok, die oft ein Mindestalter haben. Das gilt auch für Plattformen wie Discord, die oft für ältere Kinder gedacht sind.
Privatsphäre-Einstellungen anpassen
- Social Media: Stelle sicher, dass das Profil deines Kindes auf privat ist, damit Fremde keinen Kontakt aufnehmen können.
- Games: Bei Online-Spielen kannst du den Chat einschränken, sodass nur Freund*innen mit deinem Kind sprechen können.
Wichtig: Sprich mit deinem Kind über digitale Medien und schaue immer genau hin – technische Einstellungen können ein Gespräch nicht ersetzen!
Weitere Infos zur Gerätesicherheit findest du hier auf unseren Seiten in unserem Beitrag Digitale Medien – aber sicher!
Was bedeuten USK-Siegel auf Games?
Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (kurz USK) ist in Deutschland für die Prüfung von Alterseinstufung von Games zuständig. Die farbigen Alterskennzeichen geben folgende Hinweise und helfen dir bei der Einschätzung von digitalen Spielen.
Die Altersfreigaben zeigen, ab welchem Alter ein Game sicher gespielt werden kann. Zusätzlich gibt es wichtige Informationen, warum das Spiel diese Altersfreigabe hat. Z.B. wegen Inhalten, die dem Glücksspiel ähnlich sind. Auch Hinweise zu Funktionen wie In-Game-Käufen sind dabei.
Die Alterskategorien sind:
- USK 0: Für alle Altersgruppen
- USK 6: Ab 6 Jahren
- USK 12: Ab 12 Jahren
- USK 16: Ab 16 Jahren
- USK 18: Nur für Erwachsene
Reicht es aus, das USK-Siegel zu prüfen, um meinem Kind das Spielen zu erlauben?
Die USK-Einschätzungen sind hilfreich, um Spiele besser einordnen zu können. Du kannst dann den Zugang für dein Kind beschränken. Du solltest dich jedoch nicht nur auf die Altersfreigaben verlassen.
Jedes Kind entwickelt sich unterschiedlich. Ein Spiel mit USK 12 kann für ein empfindliches Kind zu viel sein, während ein anderes Kind im selben Alter besser damit umgehen kann.
Die USK bewertet nur die offline Inhalte eines Spiels. Wenn ein Spiel online gespielt wird (z.B. Multiplayer-Games), können die Kinder auf unkontrollierte Inhalte oder nicht passende Sprache von Mitspielenden treffen, die nicht von der USK überprüft werden kann! Das gilt auch, wenn ein Game oder eine Community die Kommunikation über Plattformen wie Discord oder TeamSpeak benötigt.
Du solltest darum:
- Das Spiel selbst anschauen oder gemeinsam mit deinem Kind spielen. So kannst du besser einschätzen, wie das Spiel auf dein Kind wirkt.
- Immer daran denken: Jedes Kind ist anders und wird von verschiedenen Themen beeinflusst, unabhängig vom Alter!
- Auf versteckte Mechanismen im Spiel achten, wie Online-Interaktionen oder In-Game-Käufe, die nicht immer von der USK bewertet werden.
Eine Kombination aus der USK-Freigabe und deinem eigenen Blick auf das Spiel und dein Kind ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass Inhalte für dein Kind geeignet sind.
Was sind Risiken beim Gaming?
Games und Social Media Plattformen sind nicht von sich aus entweder gefährlich oder harmlos. Ob die Nutzung dieser digitalen Medien für dein Kind schädlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Gewalt, sexualisierte und diskriminierende Inhalte sind in vielen Spielen zu finden. Wie dein Kind darauf reagiert, hängt auch von seinem Alter und Wissensstand ab. Du kannst solche Inhalte erkennen, indem du selbst hinschaust, recherchierst und mit deinem Kind spielst. Bleibe im Austausch mit deinem Kind! Unsere Gesprächsleitfäden könnten dabei helfen.
Es ist viel schwieriger, versteckte Mechanismen im Spiel zu erkennen, die dein Kind dazu bringen, viel Zeit (süchtigmachende Elemente) oder Geld zu investieren.
Diese versteckten Mechanismen nennt man Dark Patterns in Games. Sie sind Designelemente, die die Spieler*innen dazu bringen, Dinge zu tun, die nicht unbedingt gut für sie sind. Sie bringen aber den Spieleentwickler*innen Geld. Diese Praktiken sind oft im Spiel versteckt und sollen die Gamer*innen verwirren. Sie sollen Zeit und Geld geben. Grob lassen sich diese Mechanismen in vier Kategorien einteilen:
- Time Patterns: Diese Muster sorgen dafür, dass dein Kind nicht aufhören kann zu spielen. Es verliert z.B. Spielfortschritt oder eine Belohnung, wenn es das Spiel zu einer bestimmten Zeit beendet.
- Money Patterns: Diese Muster bringen dein Kind dazu, während des Spielens Geld auszugeben. Dazu gehören bekannte Strategien wie Pay-to-win-Mechanismen und Lootboxen.
- Social Patterns: Diese Muster erzeugen Konkurrenzsituationen oder Druck, wenn dein Kind mit anderen spielt. Es will in seiner Gruppe akzeptiert werden, und ein Misserfolg im Spiel könnte für die ganze Gruppe schwer erträglich sein.
- Psychological Patterns: Diese Muster halten dein Kind im Spiel, auch wenn es vielleicht keine Lust mehr hat.
Beim Spieleratgeber NRW findest du eine gute Auflistung zu Dark Patterns mit vielen Beispielen.
Was hat Gaming mit Glücksspiel zu tun?
Games bieten oft zufällige Belohnungen, wie z.B. eine Lootbox. Das ist eine Schatzkiste, die man öffnen kann. Um sie zu bekommen, muss man oft echtes Geld bezahlen. Vor dem Kauf weiß man aber nicht, was in der Box oder im Paket ist.
Das ist dem Glücksspiel ähnlich: Es regt dein Kind dazu an, immer wieder Geld auszugeben, um seltene oder wertvolle Dinge zu bekommen. Es weiß dabei aber nie sicher, ob es diese Dinge tatsächlich bekommt.
In Pay2Win-Spielen (bezahle, um zu gewinnen) kann dein Kind den Fortschritt im Spiel mit echtem Geld kaufen. Das bedeutet, dass man z.B. Wartezeiten überspringen oder bessere Ausrüstung kaufen kann. Gerade in Multiplayer-Games setzt das dein Kind unter Druck oder führt zu unklarem Fortschritt.
Was an Social Media macht süchtig?
Auch in den sozialen Medien gibt es sogenannte Dark Patterns, also süchtig machende und manipulierende Elemente.
Diese Patterns können dein Kind dazu bringen, mehr Zeit, Geld oder persönliche Daten in eine Anwendung zu stecken. Hier sind Beispiele für Dark Patterns, die oft in Social Media vorkommen:
Endloses Scrollen (Infinite Scroll) und Pull to Refresh: Plattformen wie Instagram, Facebook oder TikTok verwenden endloses Scrollen, damit Nutzer mehr Zeit auf der Plattform verbringen. Anstatt das Ende eines Inhalts zu sehen, werden neue Beiträge automatisch nachgeladen. Das macht es schwer, mit dem Scrollen aufzuhören. Wenn man die Seite nach unten zieht, aktualisieren sich die Inhalte und man sieht wieder nur neue Beiträge. So entsteht eine endlose Schleife, in der Nutzer*innen mehr Zeit in der App verbringen, ohne es wirklich zu merken.
Benachrichtigungsflut (Notification Overload): Social Media-Apps senden oft unnötige oder unwichtige Benachrichtigungen, um die Nutzer*innen zurück auf die Plattform zu locken.
Versteckte Datenschutzeinstellungen: Plattformen machen es oft schwierig, Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen zu ändern. Damit man mehr Privatsphäre einstellen kann, muss man tief in Menüs suchen. Einstellungen, die den Plattformen mehr Zugang zu Daten geben, sind aber leicht zu finden.
Follower-Vorschläge und Zwang zum Netzwerken: Nutzer*innen bekommen ständig Vorschläge, neue Follower*innen hinzuzufügen, um ihr Netzwerk zu erweitern. Das geschieht oft durch technische Tools, die vorschlagen, Freund*innen von Freund*innen zu folgen oder die Kontaktliste zu übernehmen.
Temporäre Inhalte: Plattformen wie Instagram und Snapchat nutzen Inhalte, die nach 24 Stunden verschwinden, um ein Gefühl der Druck zu erzeugen. Nutzer*innen fühlen sich gezwungen, regelmäßig nachzusehen, um nichts zu verpassen.